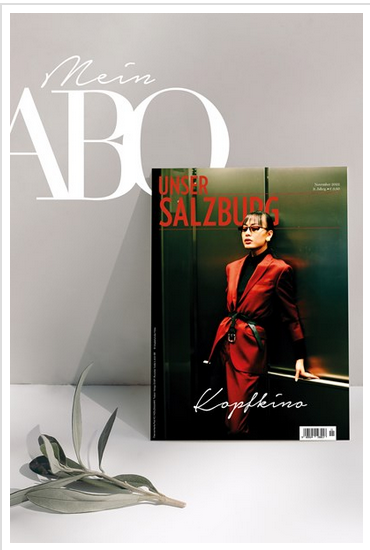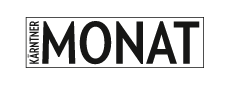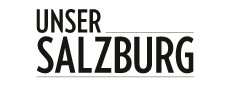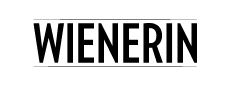Warum Rosa und Blau nicht egal sind, um Kinder unabhängig von ihrem Geschlecht sehen zu können
Dinosaurier im Puppenwagen
© Shutterstock
Warum klischeehaftes Spielzeug längst nicht egal ist, ein kritischer Blick auf Gender-Reveal-Partys und was es braucht, um Kinder unabhängig von ihrem Geschlecht sehen und fördern zu können.
Es ist „nur“ ein Zwillingskinderwagen, trotzdem bringt er mich jedes Mal zum Nachdenken, wenn ich ihn beim Spazieren sehe – denn die eine Hälfte ist blau, die andere rosa. Ich frage mich: Wird der Bursch, wenn er vermutlich in der blauen Hälfte liegt, mit Puppen spielen (dürfen)? Und vor allem: Wird das Mädchen, wenn es vermutlich in der rosa Hälfte liegt, Häuser und Türme bauen (dürfen)?
Während Spielsachen wie Puppen, die bis heute zumeist Mädchen bekommen, soziale Fähigkeiten und Empathie fördern, lassen sich mit „typischem“ Burschen-Spielzeug wie Bauklötzen und Fahrzeugen räumliches Denkvermögen beziehungsweise motorische Fähigkeiten trainieren. Das auf YouTube abrufbare BBC-Video „Girl toys vs. boy toys: The experiment“ liefert dazu eine spannende Zahl: In nur drei Monaten verändert sich das Hirn physisch, wenn Kinder häufig Spiele für das räumliche Denkvermögen spielen.
Überspitzt gesagt: Die rosa Hälfte des Kinderwagens könnte später darüber entscheiden, ob das Mädchen gut und gerne Mathe lernen wird – und ob es womöglich eine technische Ausbildung wählt, die bis dato in der Regel zu besser bezahlten Jobs führt. Und das ist nicht zuletzt ein Faktor von vielen für den im Europavergleich sehr hohen Gender-Pay-Gap von mehr als 18 Prozent in Österreich.
Sind das nicht bloß Farben? „Ob rosa oder blau wäre dann egal, wenn beispielsweise Verpackungen für Bauklötze, auf den Burschen abgebildet sind, rosa sein dürften, und für Mädchen gedachte Dinge in Grün oder Schwarz erhältlich wären. Dann wären es tatsächlich nur Farben“, sagt Katja Grafl. „Kinder stereotypisch in Schubladen einzuordnen, gibt vielleicht Sicherheit, aber sie können so nicht anhand ihrer individuellen Kompetenzen gefördert werden.“ Katja Grafl hat Politikwissenschaft mit Fokus auf Gender studiert und ist im Vorstandsteam der feministischen Organisation Sorority. Aktuell ist sie im Leitungsteam von SOS Kinderdorf, zuvor leitete sie jahrelang Projekte des Österreichischen Fonds zur Stärkung und Förderung von Frauen und Mädchen namens LEA (Let’s empower Austria). Ihre Expertise basiert beispielsweise auf Projekten wie „[UN]TYPISCH – Geschlechtersensible Pädagogik im Kindergarten“ oder dem Kinderbuch „Wer macht MI(N)T?“ – eine Sammlung aus 38 Vorbildfrauen aus Österreich.
Baby-Experiment: Andere Stimme & Sprache
Auch die Filmschaffende Katharina Mückstein lädt Erwachsene in ihrer Kinodokumentation „Feminism WTF“ (erhältlich etwa via Amazon Prime) zu einem Baby-Experiment ein und zeigt: Erwachsene passen ihr Spielverhalten – und teilweise sogar ihre Stimme und Sprache – an das von ihnen gelesene Geschlecht des Kindes an. Ein Beispiel: Dem in Blau gekleideten Kleinkind werden mit normaler Stimme Dinge erklärt.
„Während Studien belegen, dass prinzipiell mit Mädchen ab dem Kleinkindalter mehr geredet wird, weil man ihnen zuschreibt, dass sie kommunikativer sind, bekommen Burschen viel mehr technische Erklärungen. Dass einem Mädchen etwa beschrieben wird, wie ein Toaster funktioniert, passiert viel seltener als umgekehrt“, weiß Katja Grafl. Burschen machen somit in der Regel schon früh mehr positive Experimentiererfahrungen als Mädchen. Das hat Folgen: „Wenn mir etwas nie angeboten wird, lerne ich, dass das ein Bereich ist, der nicht zu mir passt.“ Eine Erkenntnis aus dem Kinderbuch „Wer macht MI(N)T?“: Die erfolgreichen Frauen in „Männer-Domänen“ hatten entweder entsprechende Vorbilder in ihrem Umfeld oder Menschen, die sie und ihre Fähigkeiten gesehen und gefördert haben.
Es würde heute kaum noch jemand öffentlich behaupten, ein Mädchen könne nicht zur Feuerwehr oder ein Bursch nicht Sozialarbeiter werden, doch die Entscheidungen zu diesen Wegen werden viel früher geebnet – oder eben verhindert. „Das menschliche Gehirn arbeitet pragmatisch und nicht ausgewogen-fair, also sind unsere Denkmuster geprägt von Klischees und Schubladen“, schreibt die deutsche Autorin, Diversity-Beraterin und Beauftragte für Antidiskriminierung Ferda Ataman. Sexismus beginne dann, „wenn Eltern, Erzieher:innen, Lehrkräfte oder die Werbung Kinder unterschiedlich behandeln, weil sie Thomas und Yasemin heißen. Das passiert meist ohne böse Absicht. Einfach nur, weil sie Mädchen und Jungen sind. Und trotzdem leiden Kinder unter diesen Zuschreibungen“, warnt sie.
Die Schubladen gehen schon vor der Geburt und mit viel Trara bei sogenannten Gender-Reveal-Partys auf: Dabei wird dem Umfeld das Geschlecht des Ungeborenen feierlich mitgeteilt, indem man etwa eine weiße Torte aufschneidet, die dann innen rosa oder blau ist. „Wird es ein hübsches Mädchen? Wird es ein kräftiger Bub? Diese stereotypischen Vorstellungen begleiten Kinder ihre ganze Entwicklung lang. Genauso wie die Rollen- und Vorbilder, die ihnen im Laufe ihres Lebens begegnen oder vermittelt werden“, heißt es im LEA-Pädagogik-Manual.

Gendermarketing
Almut Schnerring und Sascha Verlan, selbst Eltern von drei Kindern, trugen eine Vielzahl von Studien, Expert:innenmeinungen und Beobachtungen für ihr mittlerweile in zweiter Auflage erschienenes Buch „Die Rosa-Hellblau-Falle“ zusammen (Kunstmann-Verlag). Sie schreiben: „Tatsächlich ändern Erwachsene ihr Verhalten gegenüber einem Kind schon vor Geburt, sobald sie das Geschlecht des Ungeborenen erfahren.“
Die beiden riefen auch mehrere Initiativen ins Leben, wie etwa den „Equal Care Day“ oder den „Goldener Zaunpfahl“-Award, einen Preis für absurdes Gendermarketing. Dabei alarmierend: Es gibt eine Vielzahl von Beispielen, bei denen rosa bereits im Babyalter teurer ist (die sogenannte Pink Tax beginnt bei Windelsäcken und Trinkflaschen). Sie finden: „Da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt, kann es auch keine geschlechtsneutrale Erziehung geben. Eine geschlechtergerechte oder geschlechtersensible dagegen schon.“
Oder wie es Katja Grafl formuliert: „Wer möchte nicht, dass sein Kind alle Chancen bekommt und später ein möglichst zufriedenes Leben führt? – Der wichtigste Ansatzpunkt ist dabei: Selbstreflexion.“ Das gelte sowohl – wie im eingangs beschriebenen LEA-Projekt – für Pädagog:innen als auch für Eltern (und alle anderen Erwachsenen bei der Begegnung mit Kindern). „Ein Beispiel: Bei Burschen wird viel mehr Bewegungsdrang toleriert oder sogar positiv hervorgehoben, bei Mädchen hingegen stärker reglementiert.“ Die Erklärung, „das Wildsein“ hänge mit dem Testosteronspiegel zusammen, sei schlichtweg falsch; im Kindesalter läge er bei allen Geschlechtern ziemlich gleich, und zwar annähernd bei Null.
Blinde Flecken haben wir aber alle, ist Katja Grafl überzeugt. So werden Mädchen häufig für ihr Aussehen gelobt, „während man selten zu einem Burschen sagt: ,Du bist heute aber hübsch‘ “. Das wirkt sich vorwiegend für die Mädchen negativ aus, „schon mit acht Jahren beginnen sie, ihr Selbstbewusstsein zu verlieren, weil sie viel mehr auf ihren Körper reduziert werden“.
Gleichmacherei als Schlussfolge?!
Wenn nun keine Unterschiede gemacht werden sollen, käme es zu einer „Gleichmacherei“, empören sich Skeptiker:innen. Im Gegenteil, findet das Autor:innenduo von „Die Rosa-Hellblau-Falle“: „Wer findet, ,Jungs sind nun mal wild‘ und ,Mädchen sind eben ruhiger‘, wer also Kindern allein aufgrund ihres (zugeschriebenen) Geschlechts ganz bestimmte Eigenschaften und Interessen zuweist, kämmt alle Mädchen über einen pinken Kamm und steckt alle Jungen in dieselbe Ecke“, schreiben Almut Schnerring und Sascha Verlan.
Apropos Ecke: Eine gute Strategie sei es laut Katja Grafl auch, im Kindergarten (oder daheim) die Spielecken möglichst bunt zu gestalten. Wie wäre es beispielsweise damit, das rosa Prinzessinnen-Verkleidungsreich mit Werkzeuggürtel und Co. zu erweitern? Oder die Puppen-Haushaltsecke mit neuen Protagonist:innen zu bereichern? „Es kann gerne der Dinosaurier im Puppenwagen fahren, Kinder mögen solche Dinge und brauchen keine Trennung.“
Wenn nun ein Mädchen nach pinkem Glitzer greift? „Druck raus, warum nicht?“, lacht Katja Grafl. Das bedeute keineswegs, dass die geschlechtersensible Mission gescheitert ist. Schließlich gehe es nur darum, allen möglichst die gleichen Wahlfreiheiten zu bieten. Ein Bursch will die Babypuppe wickeln und herumtragen? „Sehr gut, das ist ein Rollenspiel. Vätern, die sich dabei schwertun, kann man gerne die Frage stellen: Sie haben doch auch ihre Kinder getragen, als sie Babys waren, oder?“
P.S. Sie sind schwanger und haben Lust auf ein Experiment? Bitten Sie doch Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, das Geschlecht Ihres Ungeborenen geheim zu halten, damit es ganz ohne Erwartungen in die Welt sausen kann. Wie werden Sie und Ihr:e Partner:in es wohl im Bauch ansprechen? Welche Strampler und Spielsachen werden Sie vor der Geburt einkaufen oder geschenkt bekommen?
Fragen zur Selbstreflexion
- Welche Erwartungen habe ich an Buben? Welche an Mädchen?
- Wofür lobe ich Mädchen – wofür Buben?
- Welches Verhalten ärgert mich bei Buben – und welches bei Mädchen?
- Gibt es Dinge, die ich lieber beispielsweise mit meiner Tochter/Nichte mache als mit meinem Sohn/Neffen?
- Wenn die Kids beginnen, im Haushalt aktiv zu werden: Wer kriegt welche Aufgaben?
- Welche Bücher biete ich den Kindern an: Bilden sie möglichst verschiedene Lebensrealitäten ab? Haben auch weibliche Charaktere aktive Rollen – und wie viel kommen sie zu Wort? Sind die Illustrationen stereotypisch oder spiegeln sie Vielfalt wider?